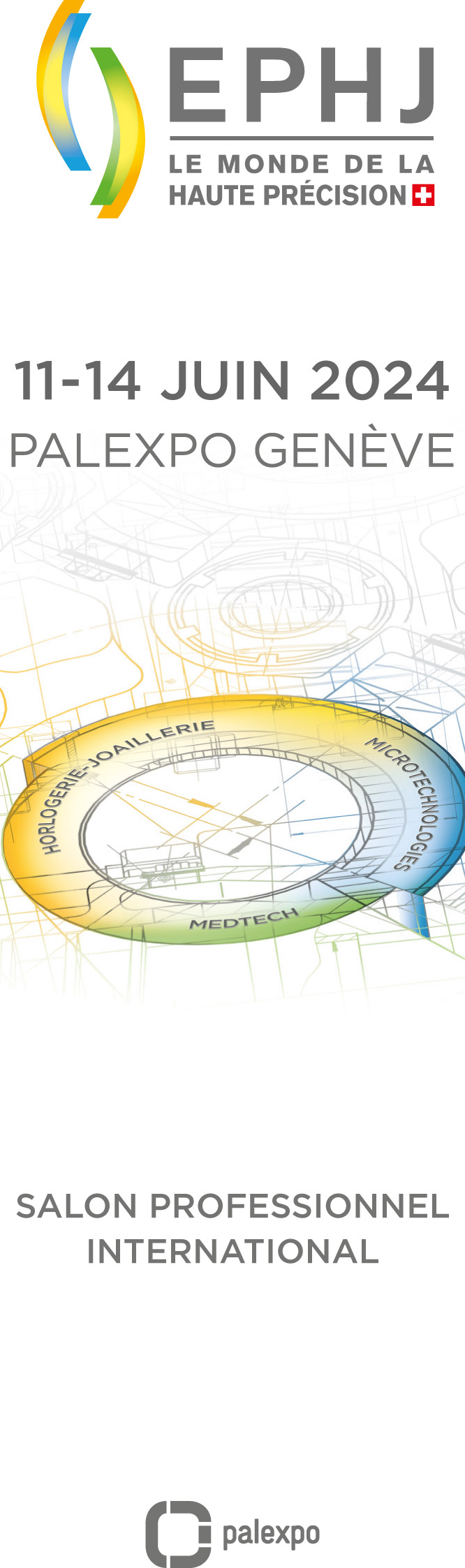Fast alle Edelsteine, Schmucksteine und Metalle liegen in kristalliner Form vor. In Kristallen sind Atome, Ionen oder Moleküle raumgitterartig angeordnet und bilden regelmässige, räumlich periodische Strukturen. Diese sind in 32 verschiedenen Symmetrieklassen beziehungsweise 7 Kristallklassen eingeteilt.
In Gläsern, amorphen Feststoffen, Flüssigkeiten und Gasen sind die oben erwähnten Teilchen im Gegensatz zu Kristallen auf ungeordnete, chaotische Weise angeordnet. In Flüssigkeiten und Gasen weisen sie zudem eine hohe Mobilität auf, ihre räumliche Konformation ändert sich ständig. Kristalle entstehen aus Schmelzen, übersättigten Lösungen oder Gasen, wobei der erste, kritische Schritt die Bildung eines sogenannten Kristallkeims ist. Dieser kann nur einige wenige Atome, Ionen (d.h. elektrisch geladene Atome) oder Moleküle umfassen, doch muss er die Periodizität und Symmetrie des an ihm wachsenden, grossen Kristalls aufweisen. An diesen Keim können sich unter Wärmeabgabe weitere Teilchen auf geordnete Weise anlagern.
Die unzuverlässige, spontane Keimbildung wird im Labor und in der Industrie oft umgangen, indem man einer übersättigten Lösung oder Schmelze ein oder mehrere Stückchen eines bereits verfügbaren Kristalls der zu kristallisierenden Substanz zugibt. Sie dienen als Kristallkeime, man bezeichnet sie auch als Impfkristalle. Auf diese Weise gelingt es unter anderem, die für integrierte Schaltungen benötigten, riesigen Silicium-Einkristalle mit einem Durchmesser von 300 bis 450 Millimetern sowie mehrere Dezimeter lange Einkristalle aus Superlegierungen für die Blätter von Gasturbinen und Flugzeugtriebwerken zu züchten. Auch die meisten synthetischen Schmuck- und Edelsteine werden mit Hilfe extern zugegebener Keime gezüchtet.
Unvollständige Theorie
Fehlerarme Kristalle sind in der industriellen Praxis wie auch in der Forschung von enormer Bedeutung. Doch die Entstehung der dazu erforderlichen, nanometergrossen Keime wird in vielen Fällen nicht ausreichend verstanden. Die klassische Theorie der Kristallkeimbildung oder Nukleation ist bald 100 Jahre alt und offenbar unvollständig. Danach muss beim Übergang von der ungeordneten, flüssigen Phase zur geordneten festen Phase eine Energiebarriere überwunden werden. Dies ist nur möglich, wenn ein Keim mit einer minimalen Grösse entstanden ist. Wird diese Barriere aufgrund thermisch bedingter Fluktuationen zufallsbedingt überwunden, so kann der Keim schnell zu einem makroskopischen Kristall heranwachsen.
Auf den ersten Blick mag es erstaunen, dass sich Atome und Moleküle überhaupt zu grösseren, geordneten Aggregaten zusammenfinden, sind doch die Teilchen aufgrund ihrer Elektronenhülle aussen negativ geladen und stossen einander elektrostatisch ab. Bei der starken Annäherung zweier Atome ergeben sich aber Änderungen der Konfiguration der Kern- und Elektronenladungen. Die Atome werden zu sogenannten Dipolen mit getrennten Schwerpunkten der positiven und negativen Ladungen, sodass sie einander schwach anziehen; man bezeichnet solche Kräfte als Dispersions- oder (zu Ehren des Physikers Fritz London, 1900-1954) auch als Londonkräfte.
Weitere Mechanismen
Nach der klassischen und bewährten Keimbildungstheorie, besteht eine scharfe Grenze zwischen den ungeordneten Atomen beziehungsweise Molekülen in der Lösung oder Schmelze und den Grenzflächen des entstehenden Keims. Zudem hängt die Nukleationsbarriere von der Fläche des Keims ab und wird beim Wachsen des Keims immer weniger wichtig. Doch ab Anfang des 21. Jahrhunderts wurde es klar, dass es noch andere Keimbildungsmechanismen gibt, insbesondere im Fall verdünnter Lösungen und Gase.
So kann eine zufallsbedingte Konzentrationsfluktuation zur Bildung eines geordnet strukturierten Keims inmitten weiterhin ungeordneter Teilchen führen. Dasselbe kann sogar mit einem einzelnen Teilchen erreicht werden, das unter günstigen Umständen die Bildung eines makroskopischen Kristalls anregt. Möglich ist es auch, dass der Keim in Bezug auf die kristallografischen Parameter nicht genau mit dem Endkristall übereinstimmt.
Keime mit diffusen Flächen
Ganz neu ist die Beobachtung von Zhou et al., dass es auch Keime mit diffusen, nur halbwegs geordneten Flächen und Kanten gibt. Nur die innersten Atome sind von Anfang an streng geordnet; die äusseren Atome gehen erst beim weiteren Wachstum des Keims in eine geordnete Struktur über. Dann nimmt der Keim über mehrere, instabile Zwischenstufen die minimal-energetische, annähernd sphärische Form an. Die Untersuchung von Keimbildungsprozessen ist ausserordentlich schwierig, weil die Keime so klein sind und nur in geringer Zahl entstehen. Sie mit den erforderlichen, hochauflösenden Instrumenten erst einmal zu finden ist schon eine Herausforderung. Zhou et al. lösten dieses Problem, indem sie die Keimbildung in einer festen, ungeordneten Eisen-Platinlegierung beobachteten. Beim Erhitzen entstand eine polykristalline Struktur, wobei jedes der Körner ein tetragonales Kristallgitter aufwies.
Die Bildung der Kristallkeime und ihr Wachstum zu makroskopischen Kristallen wurden mit atomarer Auflösung mittels Elektronentomografie beobachtet. Bei dieser relativ neuen Technik wird die Probe im eng fokussierten Elektronenstrahl eines aberrationskorrigierten Elektronenmikroskops auf kontrollierte Weise gekippt und gedreht. Dabei werden in enger zeitlicher Folge zahlreiche Bilder mit atomarer Auflösung aufgenommen. Nach der Computer-Auswertung können die Keimbildung und das Wachstum der Keime verfolgt werden. Die Autoren bezeichnen dies als vierdimensionale Tomographie mit der Zeit als vierter Dimension.
Quelle: J. Zhou et al., Nature 570, 500 (2019)