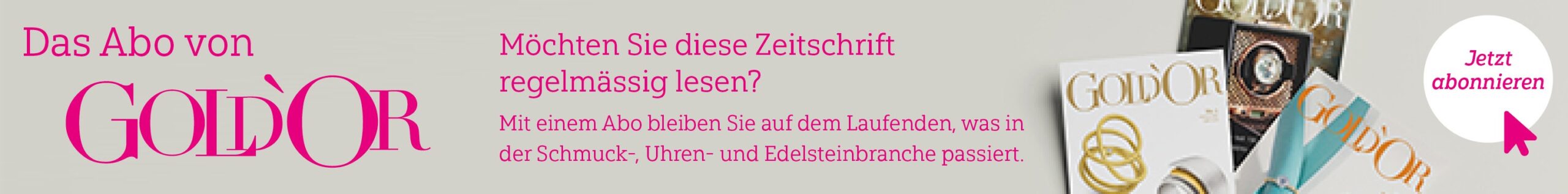Beat Schild hat in der Gold’Or 4/25 einen historischen Rückblick auf den Beruf des Goldschmiedes publiziert und aufgezeigt, wie zu tiefe Fachkräfte-Reproduktionsraten ganze Berufsgattungen gefährden. Im Rahmen eines Wirtschaftsstudiums erforscht der Goldschmied aus Brienz diesen Bereich.
Gold’Or: Beat Schild, Sie haben die Missstände beim Nachwuchs von Goldschmieden und Goldschmiedinnen und deren verwandten Berufen zum Schwerpunkt Ihrer Forschung in einem Wirtschaftsstudium gemacht. Wie sind Sie auf diese Thematik gekommen?
Beat Schild: Mein Sohn Noah hat eine Lehrstelle als Goldschmied gesucht und ich wollte ihm helfen. Da ich in der Branche bestens vernetzt bin, dachte ich, das sei ein Leichtes. Doch dem war nicht so – im Gegenteil. Wir waren schon kurz vor dem Aufgeben, als ich an einer Hochzeitsmesse eine Goldschmiedin aus der Zentralschweiz kennenlernen durfte. Sie hat sich schliesslich bereit erklärt, Noah auszubilden. Da er von Brienz bis zu seinem Ausbildungsort mit dem ÖV zweieinhalb Stunden unterwegs ist, kommt er nur am Wochenende nach Hause. Dass es so extrem schwierig ist, eine Lehrstelle zu finden, war ich mir nicht bewusst. Die Situation hat mich wachgerüttelt und ich begann zu recherchieren. Bald habe ich gesehen, dass auch bei den weiteren 120 traditionellen Handwerksberufen Missstände herrschen.
Die Nachwuchszahlen in der Goldschmiedebranche sind schon seit Jahren rückläufig. Wie schätzen Sie die Lage ein und welche Entwicklungen bereiten Ihnen Sorgen?
Wie ich schon in der Gold’Or 4/25 erläutert habe, liegt die Fachkräfte-Reproduktionsrate (FR) in der Deutschschweiz bei den Goldschmieden zwischen 0,2 und 0,3. Jedes Jahr absolvieren 300 Jugendliche den Eignungstest und bezahlen dafür 300 Franken. Davon finden bloss sieben Prozent, also etwa 20 junge Frauen und Männer, eine Lehrstelle. Erschwerend dazu kommt, dass gemäss aktuellen Erfahrungen von diesen nur etwa 20 bis 30 Prozent auf dem Beruf bleiben. Das bedeutet mathematisch analysiert, dass es in 40 Jahren noch 20 Prozent der Zahl der Fachkräfte von heute gibt und in 80 Jahren der Beruf nahezu ausgestorben sein wird.
Was fehlt aus Ihrer Sicht, um langfristig genügend Fachkräfte zu sichern?
Es fehlen einerseits das allgemeine Bewusstsein dafür, wie die Branche gefährdet ist und andererseits die Unterstützung der Öffentlichen Hand. Nur im Bewusstsein um unsere Notsituation und mit engagierten Fachpersonen können Forderungen für Unterstützung gestellt werden.
Wie kann die Attraktivität der Ausbildung zur Goldschmiedin gesteigert werden, und was braucht es, damit Betriebe motiviert werden, Lehrstellen anzubieten?
Lernende sollten einen Lehrbetrieb auswählen können, wenn erwünscht in der Nähe des Wohnortes. Es ist schlecht, wenn 16-Jährige wegen der Distanz zum Arbeitsplatz aus ihrem sozialen Umfeld gerissen werden müssen. Von Seiten der Goldschmiede sieht es so aus, dass einige sich kämpferisch geben und stark engagieren, während andere sich um nichts kümmern. Es wäre wichtig, dass möglichst alle am gleichen Strick ziehen. Jeder, der in der Lage ist, sollte ausbilden und sein Wissen weitergeben. Eine Idee wäre, dass sich mehrere kleine Betriebe eine Lernende teilen könnten. Das heutige System muss ergänzt und flexibler werden. Es müssen neue Ideen entwickelt und Forderungen an die öffentliche Hand gestellt werden.
Die Ausbildung im Handwerk lebt von der Qualität und vom Engagement der Ausbildner. Was ist Ihnen in diesem Zusammenhang wichtig?
Es ist eine Frage der Wertschätzung. Jede, die ausbildet, verdient Anerkennung. Leider hat sich das verändert, auch der Goldschmiedemeister ist entwertet worden. Weiterbildung ist ein wichtiges Thema, die Betriebe dürfen nicht alleingelassen werden, sie brauchen Unterstützung.
Veränderungen bringen oft auch Herausforderungen mit sich. Was wird momentan getan, um die Situation zu verbessern?
Der VSGU hat eine Arbeitsgruppe gebildet, die aus Andrea von Allmen als Co-Präsidentin des Verbandes, Remo Fürer vom Sekretariat, Bruno Mojonnier von Fabrefactum und mir besteht. 2027 wollen wir ein Pilotprojekt starten, um die Situation in den Griff zu bekommen.
Wie soll das aussehen?
Im Zentrum steht eine hybride Ausbildung. Dabei wollen wir die Stärken der Goldschmiedeschulen in der Westschweiz und des dualen Ausbildungsweges kombinieren. Wir denken dabei an dezentrale Lehrwerkstätten in den Betrieben. Statt einem grossen Schulhaus mit mehreren Klassen könnte es acht bis zehn kleinere Schulen für ungefähr 60 Lernende geben.
Wie sieht Ihre Vision für den Goldschmiedeberuf in der Zukunft aus?
Unsere Vision ist, aus der Schweiz ein Schmuckland mit internationaler Ausstrahlung zu machen. Wir sind für Präzision und Qualität bekannt. Dieses Bewusstsein sollte gestärkt und das Handwerk gefördert werden, sodass alle, die einen so wunderschönen Beruf wie unseren erlernen wollen, eine Chance dazu bekommen. Es ist entscheidend, dass nicht nur sieben Prozent der Willigen und Fähigen eine Lehrstelle finden, sondern alle.
Daniela Bellandi